
News (77)
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und unsere Umwelt
Written by Ekkehard HenschkeTheodor Bergmann zum 99. Geburtstag am 07.03.2015
For British and German readers please start with these pictures: http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gallery/2015/apr/01/over-population-over-consumption-in-pictures?CMP=EMCNEWEML6619I2
Human rights and our environment. Where are today's risks and how to handle them?
Gedanken zu diesem gewaltigen Thema kreisen um die Frage: Was für eine Welt hinterlasse ich eines Tages meinen Kindern und Kindeskindern? Wie sieht sie gegenwärtig aus, und was ist angesichts der Fülle von Problemen zu tun?
Wachstumsfetischismus und Weltrisikogesellschaft
Bei der Diskussion dieser beiden Problemkreise gehe ich von zwei Überlegungen aus: Zum einen, dass im Zeitalter der Globalisierung alles ökonomische, politische und ökologische Geschehen weltweit positiv wie negativ miteinander verbunden ist. Ich habe dabei das Prinzip der kommunizierenden Gefäße vor meinem inneren Auge. Zweitens, dass die aus diesem Geschehen erwachsenden Gefahren in der Regel von Menschen gemachte Gefahren sind. Es sind Risiken, die auch von uns Menschen weltweit gemeinsam auf den verschiedensten Ebenen bewältigt werden können.
Ich komme damit auf das, was der jüngst verstorbene Soziologe Ulrich Beck, der in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren auch kurz in Stuttgart-Hohenheim gewirkt hat, mit seinen Darstellungen zur Risiko- bzw.Weltrisikogesellschaft uns vor Augen geführt hat. Er hat gezeigt, dass wir aufgrund des technisch-naturwissenschaftlichen Fortschritts zunehmend dessen Folgen ausgesetzt sind und diese wiederum die Risiken von Katastrophen beinhalten; dass die Risiken nicht mehr nur lokaler, nationaler oder kontinentaler Art sind, sondern inzwischen globaler Natur geworden sind; dass sie auch nicht mehr auf bestimmte Klassen, Schichten, auf Arm oder Reich begrenzt werden können, sondern uns alle auf diesem Planeten betreffen. Ich meine insbesondere die Gefahr atomarer und klimatischer Katastrophen, die räumlich und zeitlich potentiell unbegrenzt sind. An Szenarien dazu hat es keinen Mangel. An konkreten Fällen leider auch nicht.
Angesichts der noch immer dominierenden Ideologie des ungebremsten Wirtschaftswachstums plädiert Beck daher wie viele andere Wissenschaftler[1] vor ihm für eine „Gesellschaft des Weniger“.
Das Szenario für 2015
Es gibt viele wissenschaftliche Untersuchungen aus allen Himmelsrichtungen darüber, welche Gefahren die weitere Vernachlässigung der natürlichen Umwelt haben wird und was diese auch für das friedliche Zusammenleben aller in Freiheit, Gleichheit und Solidarität bedeuten. Anfang 2015 konnten wir den zehnten Bericht des Weltwirtschaftsforums lesen. Er befasst sich mit den zwei globalen Risiko-Blöcken, die in diesem Jahr 2015 erwartet werden und auf die es zu reagieren gilt: Zum einen werden die globale Risiken genannt, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben: Dazu gehören in erster Linie zwischenstaatliche Konflikte (Ukraine), extreme Wetterereignisse, Versagen nationaler Staaten oder gar deren Zusammenbrüche (Griechenland) und die strukturelle Arbeitslosigkeit (südeuropäische Länder). Zu den weltweiten Risiken, die eine nachhaltige Wirkung haben, zählt der Bericht an erster Stelle das gesellschaftliche Problem der Wasserkrisen, dann die schnelle und starke Verbreitung von Infektionskrankheiten (Ebola), ferner die Massenvernichtungswaffen, aber auch die zwischenstaatlichen Konflikte mit ihren regionalen Folgen und – last but not least - das Ausbleiben von Reaktionen auf den Klimawandel[2]. Durchgehend verweist der Bericht auf die Möglichkeiten, diese Risiken durch weltweite Kooperation zu verringern. Über das internationale Kyoter Protokoll zum Klimaschutz soll Ende dieses Jahres wieder verhandelt werden. Die bisherigen Ergebnisse stimmen eher skeptisch.
Was bedeutet das Szenario für die Wahrung der Menschenrechte?
Was hat dies mit den Schlagwörtern der bürgerlichen Französischen Revolution „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ zu tun, die nun schon 226 Jahre zurückliegt? Sehr viel, weil wir als Individuen sehr aufpassen müssen, dass die errungenen individuellen Menschenrechte nicht unter globalen oder nationalen sogenannten Sachzwängen (z. B. Wirtschaftswachstum > Arbeitsplätze) unter die Räder geraten. Zu der Frage der Freiheit: Es heißt immer so schön: Freiheit zu leben, zu lieben, zu reden, sich zu versammeln. Dies alles schön im Rahmen der geltenden Gesetze. In den rechtstaatlich und demokratisch organisierten Staaten wachen formal die obersten Verfassungsrichter darüber, dass die Gesetze und deren Anwendung mit den verbrieften Freiheitsrechten konform gehen. Wie sieht es aber aus, wenn es zu einem Zusammenprall der Kulturen kommt? Ich denke dabei an die Auseinandersetzungen um den Islamischen Staat. Ist die Anerkennung der Menschenrechte ein dauerhaftes Ergebnis von nur europäischen geschichtlichen Erfahrungen und abendländischer Ethik? Gilt noch „Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden“?
Wie hoch das Risiko der Freiheit sein kann, haben wir durch das Massaker an den Journalisten der Pariser satirischen Zeitschrift „Charlie Hebdo“ gesehen, die die Meinungsfreiheit in Anspruch nahmen und von Islamisten bestraft wurden. In der gesamten westlichen Welt sind zu Recht die Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Sympathien für die Journalisten und den Protest gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit durch religiöse Gruppen zu artikulieren. Eine andere Gefahr für die Freiheit des Einzelnen kommt genau von der Seite, die diese zu schützen hat: Vom Staat und seinen „fürsorglichen“ Organisationen. Spätestens seit den Terrorakten von 2001 erleben wir zunehmende Bemühungen der westlichen Regierungen, zur Abwehr von Terroristen eben diese Freiheiten einzuschränken. Ich denke an die Spionageorganisationen NSA der Amerikaner, GCHQ[3] der Briten und an den BND von uns Deutschen und an deren Wünsche, ungehinderten Zugang zu persönlichen Daten zu bekommen. Ich habe in Oxford den ehemaligen Direktor der NSA, Michael Hayden, erlebt, der in verführerischen Worten für die breite digitale Überwachung der Bevölkerung der westlichen Länder plädierte, um der weltweiten Gefahr des Terrorismus, insbesondere der Islamisten, Herr zu werden. Die Enthüllungen des IT-Spezialisten Edward Snowden haben das ganze Ausmaß der bereits bestehenden Überwachung aufgezeigt. Er ist das persönliche Risiko eines amerikanischen, gut bezahlten Computerspezialisten und Verfassungspatrioten eingegangen und hat sich bei seinen Enthüllungen auf die amerikanische Verfassung mit ihren Menschenrechten bezogen. Der amerikanische Leviathan droht ihn zu verschlingen, ins Gefängnis zu werfen dafür, dass er sich ganz konkret für die Wahrung der Menschenrechte eingesetzt hat. Allerdings sitzt er nun in der Falle in Moskau. Es ist erschreckend, wie relativ gering die öffentliche Reaktion war. Die Journalisten als „die vierte Gewalt“ sind sich der Gefahren am ehesten bewusst und polemisieren gegen entsprechende Regierungsvorschläge, aber wer ist schon für Snowden und gegen die Überwachung durch NSA, GCHQ und BND auf die Straße gegangen? Auch der tapfere Hans-Christian Ströbele, unser grüner Mann mit dem roten Schal, der Snowden in Moskau traf, hat für ihn kein Aufenthaltsrecht in Deutschland durchsetzen können – weil unsere amerikanischen Freunde ihn nicht als Verfassungspatrioten sondern als international gesuchten Verräter suchen.
Gleichheit ist ein nicht minder wichtiges Menschenrecht. Nicht erst seit der umfangreichen Arbeit des französischen Ökonomen Thomas Piketty über „Das Kapital im 21. Jahrhundert“[4] wissen wir von den vielen Formen von Ungleichheit auf diesem Planeten. Aufgrund eines umfangreichen Datenmaterials, das für einige westeuropäische Staaten und die USA bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, gelangt er zu einigen „fundamentalen Gesetzen des Kapitalismus“. Für den allgemeinen Anstieg der Ungleichheit macht er die Tatsache verantwortlich, dass das Einkommen aus Kapital (ca 5 %) dauerhaft das Einkommen durch Arbeit (maximal 1,5 %) übersteigt. Aufgrund der daraus folgenden Konsequenzen für die einzelnen Volkswirtschaften und die Weltwirtschaft und ihre Menschen fordert er Umverteilung, um Ungleichheiten abzumildern, die der Marktprozess schafft, u.a. durch eine stärkere Besteuerung von Kapital sowie verstärkte Regulierung der Kapitalmärkte.
Was sind die konkreten Folgen von Ungleichheit? Fast täglich erleben wir über die Medien, wie Menschen aus armen Gegenden Nordafrikas versuchen, in die reichen europäischen Länder zu gelangen. Die gegen den Hunger in der Welt ankämpfende Organisation OXFAM hat erst kürzlich in ihrem Bericht die sich verschärfende Ungleichheit der Lebensbedingungen in Ost und West, in Nord und Süd konkret nachgewiesen[5]. Allein in der Zeit von 2009 bis 2014, als viele Länder unter Rezession, wachsender Arbeitslosigkeit, sozialen Kürzungen und fallenden Realeinkommen litten, hat sich die Zahl der Milliardäre verdoppelt. Auch OXFAM plädiert deshalb für höhere Besteuerungen aus Kapitaleinkommen und Regulierung der Kapitalmärkte, um weltweit individuelles Überleben, Leben und Wohlstand zu erreichen. Einige hier in diesem Kreis haben sicherlich wie ich die Bilder von den Zuständen in asiatischen Slums vor Augen[6]. Allein, wenn auf das Vermögen der Milliardäre 1,5 % Steuern erhoben würden, könnte man laut der OXFAM-Studie mit den jährlich eingenommenen 74 Milliarden Dollars jedem Kind in den ärmsten Ländern der Welt schulische Bildung und Gesundheitsfürsorge ermöglichen.
Brüderlichkeit ist bekanntlich der Zwillingsbruder der Gleichheit. Solidarität mit den Benachteiligten ist die Forderung nach Aufhebung von Ungleichheit.
Ein zu schwacher Trost sind da die philanthropischen Bemühungen, wie sie z. B. der ehemalige Microsoft-Gründer Bill Gates und der Spekulant Warren Buffet im Rahmen ihrer Initiative „The Giving Pledge“[7] und ihrer Stiftungen machen.
Was kann, was muss getan werden?
Die Erkenntnisse der Wissenschaftler – ich denke in Deutschland auch an den einst in Wuppertal arbeitenden kritischen Naturwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker[8] und an den Wirtschaftswissenschaftler Uwe Schneidewind[9] - und deren Wirken in der Öffentlichkeit ist ein mühsames und langsames Geschäft. Wer aber sollte Korrekturen an Fehlentwicklungen durchführen, wenn nicht die Politiker? Und die denken und handeln wiederum meist nur in vier- oder fünfjährigen (Wahl-)Perioden. Nicht selten sind sie fremden, kontraproduktiven Einflüssen erlegen. Als dritte Möglichkeit der Korrektur sehe ich die durch Protestbewegungen. Ähnlich wie die engagierte kanadisch-israelische Sozialistin Naomi Klein[10] sehe ich die Notwendigkeit, auch durch öffentlichen Druck die Politik zu bewegen. Vor allem von dem fatalen Glauben an das notwendige unbegrenzte Wachstum muss sich die Politik lösen. Dessen Folgen sehen wir in Gestalt schwindender natürlicher Ressourcen und dramatischer Klimaveränderungen. Und diese drohen fatal für die Menschheit zu werden. Dagegen, gegen neoliberale Wirtschaftspolitik, setzen alternative Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler spätestens seit den Aktivitäten des Club of Rome ihre Vorstellungen von Wachstumsrücknahme (DeGrowth). Das Ziel einer entsprechenden Umsteuerung durch eine auch solidarische Ökonomie heißt qualitatives (anstelle von quantitativem), selektives (besonders wertvolle Sektoren betreffendes) und nachhaltiges Wachstum, das im Rahmen demokratischer und solidarischer Strukturen erreicht werden soll.
Das bedeutet natürlich eine massive Kapitalismuskritik und reichlich Widerstände. Trotz des notwendigen öffentlichen Drucks auf die Politik: Meiner Meinung nach kann es keine revolutionären Lösungen geben, sondern angesichts der globalen Vernetzung der Volkswirtschaften nur gemeinsame evolutionäre Lösungen. Einseitige oder revolutionäre Lösungen würden das ganze, ohnehin labile System der Weltwirtschaft zu Lasten aller gefährden. Ein kleines Beispiel, wie schwierig so etwas in einem Land mit einer dominierenden Finanzwirtschaft ist: Ich habe vor zwei Jahren zufällig eine Sitzung des englischen Oberhauses erlebt, in der über die Regulierung der britischen Banken diskutiert wurde. Die Resultate allein für die Londoner City, Zentrum der britischen und weltweit agierenden Finanzwirtschaft, sind jedoch bisher dürftig gewesen. Steuerflucht gerade der Reichen und wieder anschwellende Kreditblasen machen staatliches Eingreifen aber notwendig. Deshalb kann auch das Problem der britischen Finanzwirtschaft nur im Rahmen von Verhandlungen innerhalb der Europäischen Union gemeinsam gelöst werden.
Wie wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, gibt es durchaus Möglichkeiten, auf evolutionäre Weise politische, soziale und wirtschaftliche Verhältnisse zu verändern. Ich denke an die Bürgerbewegungen mit Petitionen und Volksentscheiden[11], auch an die sehr diskussionsbedürftige Pegida-Bewegung und natürlich an die alte Antiatomkraft-Bewegung, die zumindest im Unterbewusstsein der Deutschen geblieben ist und traurigerweise durch die Reaktorunfälle in Japan späte Erfolge gehabt hat und zur Energiewende beigetragen hat. Und ich denke an die großen technischen Fortschritte im Bereich der erneuerbaren Energien, die auch in Schwellenländern wie China und Indien z.T. bereits genutzt werden. Die Leugnung des Klimawandels wie jüngst im amerikanischen Kongress (im Zusammenhang mit einer Riesen-Pipeline) ist und bleibt hoffentlich nur ein welthistorisches Kuriosum.
Wie kann jetzt schon gehandelt werden?
Hier können wir auf bewährte solidarische Werkzeuge in der Wirtschaft zurückgreifen, insbesondere auf das Instrument der Genossenschaften. In den 1970er und 1980er Jahre gab es in Deutschland eine Gründungswelle im Bereich der alternativen Ökonomie, aber auch Rückschläge (Neue Heimat). Im Ausland, z.B. in Brasilien, entstanden die Kooperativen. Aber auch Kraftakte der Politik der jüngsten Zeit sind möglich. In Deutschland kann man gegenwärtig die Bemühungen verfolgen, wie auf regionaler und lokaler Ebene die von der Bundesregierung initiierte schwierige Energiewende umgesetzt werden kann. „Weg von der Atomenergie, hin zur emissionsfreien Energieerzeugung“ ist ein großer Kraftakt. Er hat eine Fülle von regionalen und lokalen Initiativen verstärkt freigesetzt, die sich auch ökonomisch rechnen. Dabei wird man sich allerdings auch zunehmend bewusst, welche ästhetischen und letztlich wirtschaftlich-sozialen Probleme man sich mit der Einführung erneuerbarer Energieerzeuger wie Windkraftwerke und Photovoltaikanlagen einhandeln kann, aber auch welch interessante Variationen es inzwischen gibt. Dazu lohnt auch mal ein Blick aus der sogenannten Froschperspektive. Große Dinge müssen nicht nur von Staaten und erst recht nicht von global operierenden Unternehmen oder einigen philanthropisch gesinnten Superreichen geschehen. An vielen Orten kann man bürgerschaftliches Engagement für den Umweltschutz entdecken.
Die vom Menschen gestaltete Kulturlandschaft wird kritisch betrachtet, wenn sie durch großflächige Solaranlagen und Windräderanlagen denaturiert wird. Kein Geringerer als Immanuel Kant hat schon von einem „Anspruch des Menschen auf eine Natur, die ihn ästhetisch anspricht“, von einem unmittelbaren Interesse am Naturschönen, das er als „Wohlgefallen a priori“ definiert gesprochen[12]. Deshalb verdienen Überlegungen, wie mit Hilfe eines Kulturlandschaftsplanes auf lokaler Ebene Energie ökonomisch, sozial und ästhetisch verträglich erzeugt werden kann, besondere Beachtung. Zur Definition des Kulturlandschaftsplans. Darunter versteht der Fachmann „eine informelle Planung, die darauf abzielt, für den ländlichen Raum eine wirtschaftlich tragfähige Basis für die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft zu schaffen. Diese Basis soll den ländlichen Raum durch ein dezentrales Energiekonzept autark, ökologisch sowie CO²-neutral machen und den Energiepreis langfristig stabil halten“[13]. Das Konzept eines Hallenser Landschafts- und Umweltplaners schlägt vor, mit Hilfe bereits vorhandener Technologie die außerhalb bestehender Wälder vorhandenen Hölzer in Energie umzuwandeln und für die lokale Nutzung über Kraft-Wärme-Koppelung bereit zu stellen. Die Organisation dieser Nutzung und dauerhaften Pflege der Allmende-Ressourcen (Flurhölzer) sowie der Betrieb der technischen Einrichtungen sollen von der Dorfgemeinschaft erfolgen. Der wiederbelebte Gedanke der im Mittelalter wohlbekannten Allmende, d.h. der Gemeingüter (Commons)[14], hat neben dem ökonomischen Effekt auch eine starke soziale Bindungskraft. Dieser Wissenschaftler hat auf die positiven ökologischen Wirkungen hingewiesen, die mit der Nutzung und dauerhaften Pflege von Gehölzen in der Kulturlandschaft auf diese Weise verbunden sind: u.a. Schutz des Dorfes vor Unwetter-Kollateralschäden, Schutz gegen Bodenerosion, Habitat für wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen. Wie wir von dem starken Anstieg der Energiegenossenschaften in Deutschland – von 66 im Jahre 2001 auf gegenwärtig rund 1.000 - wissen, ist diese Form der Energiegewinnung und –nutzung eine wirtschaftlich und soziale Alternative zu privatwirtschaftlichen und staatlichen Energieunternehmen geworden.
Die Quintessenz all dieser Gedanken: Global denken und lokal handeln, und dies nicht gegeneinander sondern miteinander.
Die Nachrichten über Erdbeben, Konflikte, Spionage unter Freunden und andere große und kleine Probleme lassen uns oft vergessen, dass es die Kunst, die Musik und die Literatur noch gibt, die uns erheben kann. Hier ein kleines Beispiel dafür von Ruth Stumme (1917-2006).
Nach dem Sturme
Als ich vom Schlaf erwachte,
war der Sturm verrauscht.
Und aus des Himmels
regenschwerem Grau
schien mir die Sonne,
und ein kleines Blau
erhellt’ den Tag. –
Es ließ ihn wachsen
bis zum Firmament,
an dem nun
deines Herzens Wärme brennt
Eine griechische Tragödie, der Chor der internationalen Medien und deutsche Empfindlichkeiten
Written by Ekkehard HenschkeWir haben die griechische Tragödie[1], in Brüssel aufgeführt, sehr intensiv und extensiv durch die Medien miterlebt, auch den Zorn einiger Staaten, besonders Griechenlands, auf Deutschland. Bei dem europäischen Versuch, Griechenland vor dem wirtschaftlichen Kollaps zu retten, scheint es so auszusehen wie im Privaten: Bei Geld hört die Freundschaft auf. Fest steht: Wie so häufig müssen auch in Hellas in erster Linie die kleinen Leute leiden, während die Wohlhabenden rechtzeitig ihr Geld in Sicherheit bringen konnten. Wie also können in den nächsten Wochen und Monaten der Kollaps und die politischen und sozialen Folgen verhindert werden?
Die Höhe der angelaufenen griechischen Schulden ist einfach zu hoch, als sie von diesem Land allein geschultert werden könnten. Viele Fehler sind von allen Seiten in den letzten Jahren gemacht worden, von den Gläubigern und dem Schuldner Griechenland. Angesichts des aufgezwungenen Sparkurses erheben sich berechtigte Fragen: Wie soll die griechische Wirtschaft jemals wieder wachsen können, wenn der Kapitalverkehr stark eingeschränkt ist, die griechischen Banken nicht voll funktionieren können, der Zahlungsverkehr und die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen dort nicht möglich ist. Durch Anhebung der Mehrwertsteuer verteuern sich in der Regel die Preise. Gleichzeitig muss der Staat sparen (insbesondere durch Entlassungen, Reduktion der Renten, Kürzungen der Verteidigungsausgaben). Wie will man die weitere Drosselung der Binnennachfrage vermeiden – neben dem Rückgang beispielsweise der so wichtigen Einnahmen durch den Tourismus? Wie will man die Steuerehrlichkeit der Griechen fördern, wenn man dort – ohne effiziente Finanzverwaltung – die großen potentiellen Steuerzahler verschont? Will man wirklich die junge, intelligente Generation Griechenlands, die in Folge jahrelanger politischer Versäumnisse in die Arbeitslosigkeit getrieben wurde, in die nördlichen Euroländer vertreiben, wo sie gern aufgenommen würden? Fragen über Fragen, die immer wieder zu der Forderung nach einem Schuldenschnitt führen. Auch wenn sich bisher die Erkenntnis noch nicht durchgesetzt hat: Ohne einen Schuldenschnitt (Englisch: „haircut“), d.h. ohne den Verzicht der öffentlichen und privaten Gläubiger gegenüber Griechenland, bei gleichzeitiger, kontrollierter Durchsetzung von Reformen in Griechenland ist die (Er)Lösung von der griechischen Tragödie nicht möglich. Als stärkste Wirtschaftsmacht in der Eurozone ist hier Deutschland, das bisher den europäischen Gedanken besonders unterstützt hat, auch besonders gefordert.
Schade und unfair war es, dass nicht alle Fakten in den vergangenen Wochen genannt wurden. Insbesondere die deutsche Seite hat Einiges schlecht kommuniziert, z.B. dass Wolfgang Schäuble, ein Schwabe und deutscher Finanzminister, häufig als böser Bube (oder noch schlimmer) betitelt, erst vor wenigen Jahren mit Mühe die sogenannte Schuldenbremse durchgesetzt hat. Sie bedeutet, dass es in Deutschland dem Bund und den einzelnen Ländern gesetzlich verboten ist, in „normalen Zeiten“ Schulden zu machen. In Deutschland hat es Schäuble auch erreicht, dass 2015 erstmals keine neuen Schulden im Staatshaushalt des Bundes („Schwarze Null“) gemacht wurden. Er mag sich vielleicht sogar noch vage an seinen Vorgänger, den Bundesfinanzminister Fritz Schäffer erinnern, der in den 1950er Jahren einen “Julius-Turm“[2], die thesaurierten Überschüsse des Bundeshaushaltes“ (8 Milliarden D-Mark = ca. 35 Milliarden Euro heute), zusammensparte.- Ein noch Wichtigeres kommt hinzu: Die fortdauernde Sorge im Langzeitgedächtnis der Deutschen, dass es wieder eine Inflation – wie in den 1920er Jahren - geben könnte. Die Regierung Helmut Kohl hatte sich aus politischen Gründen (um die europäische Einigung voranzutreiben) von der D-Mark getrennt und die gemeinsame europäische Währung, den Euro, zusammen mit anderen Ländern im Jahre 2002 eingeführt. Bis heute trauern viele Deutsche der damaligen, stabilen D-Mark nach. Das sind wichtige (Hinter)Gründe, warum Schäuble und Merkel so hart mit den Griechen verhandelten. Viele Regierungen, auch die konservative britische, sind gegenwärtig mit der Konsolidierung ihrer Haushalte beschäftigt. Die hohe Kunst besteht darin, die Schulden abzubauen und die Wirtschaft zu fördern, ohne dabei politische und soziale Verwerfungen zu produzieren.
Fast völlig ausgeblendet wurde in der bisherigen deutschen Diskussion, dass Westdeutschland nach 1945 umfangreiche Hilfe insbesondere von den USA erhielt und wie die alte, reiche Bundesrepublik der maroden Wirtschaft der neuen, aber armen Bundesländer ab 1990 ganz massive finanzielle und personelle Hilfe gewährte. Erst auf diese Weise konnten in den vergangenen 25 Jahren zwar keine „blühenden Landschaften“, aber eine weitgehende Gesundung der ostdeutschen Wirtschaft mit moderner materieller und institutioneller Infrastruktur erreicht werden. Insofern sollten bei den künftigen Verhandlungen mit der griechischen Regierung auch die deutschen Erfahrungen mit einer Transfer-Union im europäischen Rahmen eingebracht werden. Es geht auch, aber eben nicht nur um den Euro.
Angesichts so vieler Probleme, die in Europa zu lösen sind – Süd-Nord-Migration, eigene demographische Entwicklung, Umweltprobleme, Ukraine-Konflikt - , muss sich Europa auf den alten Erfahrungssatz besinnen: Nur Einigkeit macht stark. Es geht um das gemeinsame, auch von Griechenland mit erbaute europäische Haus.
Am Ende eines von menschlicher Gewalt und Verzweiflung, aber auch Hoffnung und Liebe geprägten Jahres bin ich wieder zu den großen Meistern deutscher Musik zurückgekehrt. Sowohl Johann Sebastian Bach als auch Georg Friedrich Händel haben mit ihrer geistlichen Musik auch Nichtgläubigen große Geschenke gemacht.
Während in Deutschland das „Weihnachtsoratorium“ von Bach - am eindrücklichsten gehört vom Thomanerchor in der Leipziger Thomaskirche – das im Dezember am meisten gespielte Stück ist, freut man sich in Großbritannien auf den „Messias“ von Georg Friedrich Händel. Händels Oratorium wurde 1742 in Dublin uraufgeführt. Beide Komponisten, die im gleichen Jahr 1685 geboren wurden, sind sich leider angeblich nur fast begegnet.
Während Bach im mitteldeutschen Raum (insbesondere in Eisenach, Köthen und Leipzig, wo er 1750 starb) wirkte, war der mit Georg Philipp Telemann befreundete Händel ein Mann von Welt. Er stammte aus Halle an der Saale, bereiste Italien und wies Hamburg, Berlin, Dublin und vor allem London, wo er 1759 starb, als Stationen seines Wirkens auf. Im Gegensatz zu Bach war Händel auch ein recht wohlhabender Komponist.
Hier eine Kostprobe des „Messias“ im King’s College, Cambridge:
https://www.youtube.com/watch?v=AZTZRtRFkvk
Mozart und Beethoven, vor allem aber Felix Mendelssohn Bartholdy waren es, die die innovative Musik Bachs nach einer Zeit des Vergessens wieder ins Bewusstsein gehoben haben.
Möge bei all dem menschlichen Elend, das gegenwärtig die vielen Flüchtlinge in Europa erleben müssen, Bachs Weihnachtsoratorium musikalisch Mut machen zur Solidarität. Die Aufnahme mit dem Leipziger Thomanerchor, die etwas älter ist, wurde jedoch nicht in der Thomaskirche aufgenommen (bitte anklicken):
https://www.youtube.com/watch?v=s_liarGxf4s
Das Innere der gotischen Thomaskirche in Leipzig, in der auch J.S. Bach begraben ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomaskirche_(Leipzig)#/media/File:Leipzig-ChurchStThomas-Interior.jpg
Ein schönes Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2016
Berlin befand sich in den letzten 14 Tagen im Taumel der 66. Internationalen Filmfestspiele. Zugleich warf die Ausstellung „Kunst aus dem Holocaust“, in der 100 Werke aus der jüdischen Gedenkstätte Yad Vashem im Deutschen Historischen Museum zu sehen sind, ihre langen Schatten. Damit zeigte sich erneut sehr deutlich, wie sich diese europäische Hauptstadt einerseits ihrer Vergangenheit stellt und andererseits dem Glanz der Gegenwart Raum und Zeit gewährt.
Ich habe beide Ereignisse intensiv wahrgenommen und mich auch über den Star George Clooney gefreut, der als politisierter Sympathieträger die in Bedrängnis geratene Bundeskanzlerin in der Flüchtlingsfrage unterstützte. Das Filmfestival zeigte, wie viele starke Frauen unterschiedlichen Alters es zur Zeit in dieser Kunstbranche gibt. Nur ein paar Namen: Die Jury-Vorsitzende Meryl Streep hatten sowohl die deutschen Medien als auch die Berliner schnell in ihre Herzen geschlossen. Die Dänin Trine Dyrholm (s. u. mit Meryl Streep) wurde als beste Hauptdarstellerin in „Kollektivet“, Thomas Vinterbergs Film über eine komisch-tragische Wohngemeinschaft der 1970er Jahre, ausgezeichnet. Die französische Regisseurin Mia Hansen-Love, die für „L’Avenir“ mit Isabelle Huppert einen Preis gewann, ist ebenso zu nennen wie Anne Zohra Berracheds Film „24 Wochen“, der mit Julia Jentsch in der Hauptrolle das heikle Thema Spätabtreibung behandelte.
Der Goldene Bär ging 2016 an den italienischen Film „Fuocoammare“ von Gianfranco Rosi, der als Dokumentarfilm das Flüchtlingsdrama bei Lampedusa zeigte. Den Großen Preis der Jury erhielt Danis Tanovic für den bosnischen Film „Death in Sarajevo“, ein spannender und nachdenklich machender Streifen über diese von der Geschichte gezeichnete Stadt und ihre Bewohner.

Die Cineasten kamen in Berlin sowohl bei den Filmen im Wettbewerb als auch bei denen im Panorama- und Retrospektive-Programm auf ihre Kosten. Dafür sorgte – neben den zivilen Eintrittspreisen - auch eine Vielzahl von Spielstätten im Zentrum Berlins, wozu als größtes Kino mit 1.900 Plätzen der Friedrichstadt-Palast gehörte.

Und außerhalb der Hauptstadt, als reizvolles Theater im Kiez, präsentierten sich mit 300 denkmalgeschützten Sesseln die Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow bei Berlin, die von einer Genossenschaft (!) betrieben werden. Man beachte die unterschiedlich langen roten Teppiche…

Nicht minder spannend waren die cineastischen Rückblicke, die zugleich deutsche Zeitgeschichte vermittelten. Dabei zeigten sich zum einen das Jahr 1965/66 und zum anderen die Vergleiche zwischen den Filmproduktionen in Ost- und Westdeutschland als besonders aufregende Aspekte. Hier der in die Vergangenheit gerichtete Film von Volker Schlöndorff „Der junge Törless“ (nach dem Roman von Robert Musil) und dort der unter der – damaligen - Gegenwart leidende DEFA-Streifen „Karla“ von Hermann Zschoche (1966). Den Letzteren gab es sowohl in der zensierten als auch in der nachbearbeiteten Fassung von 1990 zu sehen. Die Hauptdarstellerin Jutta Hoffmann war schlicht bezaubernd.
Zurück zur Ausstellung „Kunst aus dem Holocaust“, in der die Bilder und Gedichte aus einer zumeist deutsch-jüdischen Kultur noch bis zum 03.April gezeigt werden. Unter den zahlreichen ermordeten Künstlern, deren Werke gerettet werden konnten, befand sich auch Selma Meerbaum-Eisinger (geboren 1924 in Cernowitz, gestorben 1942 in einem Arbeitslager am Bug). Aus dem Gedicht „Lied“ der Sammlung „Blütenlese“ (erschienen in Stuttgart bei Reclam 2013) stammt diese letzte Strophe von 1941:
„Nimm hin mein Lied.
Vielleicht bringt es
Das Lachen einst zurück.
Und wer es liest,
Der sagt: Ich seh’s,
Und meint damit das Glück.“
EU – EURO – BREXIT und andere äußere und innere Verrenkungen
Written by Ekkehard HenschkeHeute, am 15.April 2016, hat in Großbritannien die Kampagne um den sogenannten BREXIT begonnen. In dem Referendum am 23. Juni entscheiden die Briten, ob das Vereinigte Königreich in der Europäischen Union bleiben soll oder nicht. Gegenwärtig liegen die Chancen dafür bei etwa 50 : 50 - bei leichten Vorteilen für die Brexit-Befürworter, also für einen Austritt.
Die Wogen in der Öffentlichkeit gehen hoch (vgl. z.B. den Stimmungsbericht von J. F. Jungclausen in ZEIT-ONLINE vom 15.04.2016: http://www.zeit.de/2016/15/brexit-eu-grossbritannien-wales-referendum-landwirtschaft-schafzucht). Die konservative Presse (voran „THE DAILY TELEGRAPH“) unterstützt den Oberbürgermeister von London, Boris Johnson, der sich – zusammen mit vier Mitgliedern der konservativen Regierung – an die Spitze der EU-Kritiker gesetzt hat. Insulare Selbständigkeitswünsche (möglicherweise auch Erinnerungen an das Empire), Ängste vor zu vielen Einwanderern und scheinbar pfiffige Gewinn- und Verlustrechnungen werden dabei vermengt mit der Abneigung gegen „Fremdbestimmung“ aller Art, die aus der Brüsseler Bürokratie und von der Straßburger Gerichtsbarkeit kommen. So vermengt Johnson im offenen Duell mit dem „befreundeten“ David Cameron in seiner geschickten Polemik die Forderung nach dem Austritt mit der Forderung, den jährlichen EU-Beitrag Großbritanniens einzusparen. Er schlägt im heutigen Daily Telegraph vor, diesen Betrag von 13 Milliarden Pfund für die Finanzierungslücken des britischen Gesundheitssystems „National Health Service“ (NHS) zu verwenden. Ihm kommt zugute, dass „rein zufällig“ ebenfalls heute wieder neue Hiobsbotschaften über den NHS laut geworden sind (stark gestiegene Defizite, unzumutbare Wartezeiten der Patienten auch in Notfällen). Darüber berichtete auch die liberale und linke Presse (voran „THE GUARDIAN“) immer wieder, die für einen Verbleib Großbritanniens in der EU eintritt. Diese Medien hatten Mühe, den unbequemen Führer der Labour Party, Jeremy Corbyn, dafür zu gewinnen, sich für den Verbleib einzusetzen. Mit Ausnahme von vier Ministern plädiert die britische Regierung unter dem anfangs wankelmütigen David Cameron ebenfalls für den Verbleib in der EU. Maßgebliche Kreise der Wirtschaft und auch die Bank of England warnen seit Monaten vor den ökonomischen Folgen eines Austritts, die durch die Unsicherheit über den Ausgang des Referendums schon jetzt sichtbar wären. So ergibt sich eine merkwürdig schwache und zugleich „unheilige“ Allianz aus Wirtschaft (besonders Finanzwirtschaft), uneinheitlicher Regierung und Opposition, die sich primär aus ökonomischen Gründen gegen den Brexit ausspricht.
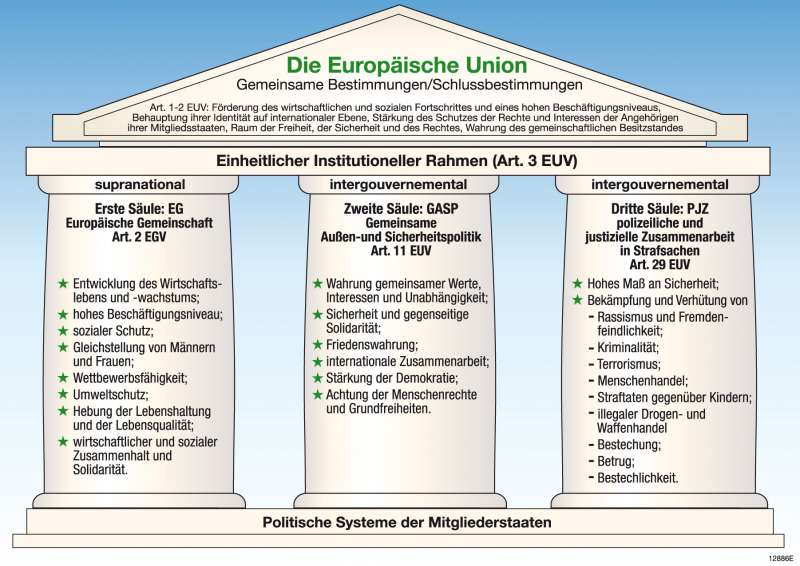
Was den Beobachter vom Kontinent, der gegenwärtig von schwächelnden Volkswirtschaften (außer Deutschland) sowie von EURO-, Griechenland- und Flüchtlingsproblemen reichlich geplagt ist, besonders irritiert, sind zwei Aspekte: Erstens, dass in der britischen Diskussion die geopolitischen Gefahren Europas (Ukraine-Konflikt mit Russland, IS-Terror) ebenso aus den Augen verloren wurden wie die regionalpolitischen Konflikte (Separationswünsche Schottlands, Katalonien). Zweitens, dass in den britischen Medien fast ausschließlich die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte des Brexits, nicht aber die Fragen einer europäischen Identität nach Jahrhunderten der Kriege und Feindschaften diskutiert werden. Da erfreut es den Beobachter besonders, wenn er auf einzelne Stimmen stößt, die genau auf diesen Punkt hinweisen. Dazu gehört der ehemalige Banker und Handelsminister der liberal-konservativen Regierung Stephen Green. Er hat jüngst (The European Identity. Historical and cultural realities we cannot deny. London 2015) die Besinnung auf die gemeinsame, oft traurige europäische Geschichte eingefordert, in deren Verlauf dem europäischen Haus so viele kulturelle Glanzlichter (Philosophen, Komponisten, Künstler, Wissenschaftler) aufgesetzt wurden. Letztlich folgt daraus die Forderung: Einigkeit macht stark. Um im Bild zu bleiben: Wenn beide Teile des europäischen Hauses, der kontinentale wie der insulare Teil, gegenwärtig von mehreren Stürmen bedroht sind, kann man nicht einfach ausziehen. Also gilt es, weiterzuarbeiten an diesem Generationenwerk und die vorhandenen Baustellen (einheitliche Wirtschafts-, Sozial- und Außenpolitik, Bürokratieabbau) schnellstmöglich zu reparieren.
BREXIT ? The EU Referendum viewed from Ireland and Germany
Written by Ekkehard HenschkeAn urgent letter:
Dear British Friend and Colleague,
thank you so much for your thoughtful and full email about the EU Referendum. I have read it several times. It goes without saying that the me-me-me money-money-money level on which the debate is being conducted in the UK is absolutely appalling. Like you I have a vision of Europe which is about a shared intellectual history and set of values, a shared visual culture going back to Greece, a shared musical and cultural world and a vision of peace and co-operation. My view is influenced by the Germans - the Germans do remember what war was like and many Germans do have a vision of this shared culture. My view is also an Irish one. What the EU has done to help Ireland open up and become more tolerant and remember th deep European heritage it had for centuries before the ghastly obscurantism after Irish independence is for me a great good.
If Britain leaves, then Britain can change nothing about the EU. It will in my view be an unmitigated disaster. The EU does need to change in many ways but Britain absolutely must stay in and help. It will be bad for the EU if Britain leaves, as Britain is needed to keep the balance between France and Germany and to promote democratic values, at a time when some of the former Eastern bloc countries are moving so far to the right. It will be bad for Britain, as it will become an inward-looking little poodle of the US, worrying about cricket and the queen. And the UK will break up, as Scotland will vote to stay in the EU. I remember how insular Britain was when I first came there forty years ago and how self-satisfied it was, and I can hardly believe how much it has changed for the better. And, while the Republic of Ireland will be rubbing its hands at the thought of all those firms which will relocate to Ireland, what about the inner-Irish border? What on earth will Ireland be going back to if such a border is recreated?
You complain about how the EU has treated Greece. Yes, it has had a hard time. So did Ireland, but they used the opportunity to reform some things and many people in Ireland were glad to have their own fat cats rapped over the knuckles and a troika coming in and sorting things. Greece needs to have its debt remitted, certainly, or it will never come out of recession, but perhaps some of its fat cats have been made to pay some taxes and register their property by now. You also talk about how disgusting it is that Germany is cosying up to the appalling Erdogan. Well, had the UK taken 200,000 asylums seekers as Sweden has done, perhaps that would not be so necessary! (And not just the UK, of course). Yes, I know the UK is giving lots of money to keep people in camps in Turkey, but that's not a future for those unfortunates. Everyone whom I know in Germany is helping to integrate asylum seekers. Why? Because that is how decent Europeans do things and because Germans have a memory of fleeing themselves and being looked down on as refugees and having to start all over again.
You yourself mentioned how important EU rules about workers' rights, the environment, etc, are. I agree. Speaking as someone who works in a British University, leaving the EU would be a disaster. You can forget about research in the Humanities, for starters, as the UK virtually does not fund it, but lots of other important research programmes will not be funded either. The European Research Council and other smaller EU funding bodies are life-lines for British research.
I cannot bear the thought that the UK will go back to where it was 40 years ago. I cannot bear it to refashion itself in the image of Gove and Johnson. Or God help us, Trump.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.Juni 1953 - 17. Juni 2016
Wie die Zeiten sich ändern: Bis 1990 wurde in Westdeutschland regel- und mäßig an den Arbeiteraufstand in Ostdeutschland erinnert. Als 13-Jähriger bin ich an diesem Tag zur Sektorengrenze in Berlin-Wedding geeilt und erlebte, wie Verletzte vom Potsdamer Platz in den Westsektor gebracht wurden und später sowjetische Panzer auffuhren und noch einige Tage später mehrere Erschossene feierlich beigesetzt wurden. Beide Teile Deutschlands sind inzwischen 16 Jahre lang wiedervereint und das in einem ebenso vereinten Europa. Ich hoffe, dass dieses Europa jetzt nicht zerbricht ...
2017 - ein Jahr wachsender Unsicherheiten?
Written by Ekkehard HenschkeKonflikte - Flüchtlinge - Trump
Natürlich sieht in dieser dunklen Jahreszeit Vieles düster aus. Was für ein Wunder auch angesichts der anhaltenden Konflikte in der Welt, die mehrere Flüchtlingswellen ausgelöst haben, angesichts der Ungewissheit, wie der neue amerikanische Präsident Donald Trump seine Außen- und Innenpolitik gestalten wird, und wie der Ausstieg Großbritanniens (BREXIT) auf dieses Land und auf die Europäische Union zurückwirken wird. Und – wie so oft – hängt all dies eng miteinander zusammen.
Die Lösungen von inneren und äußeren Konflikten hängen stark von dem guten oder schlechten Willen der aktiven Staatsmänner ab. Das schlechte persönliche Verhältnis des amerikanischen Präsidenten Barack Obama zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem Exponenten der neuen russischen Großmachtpolitik, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass sich Putin von Obama nicht als Gleichberechtigter behandelt fühlte. Dies (und die davor liegende, unsägliche Politik der EU gegenüber der Ukraine) hat eine Lösung des Ukraine-Konflikts verhindert, den syrischen Bürgerkrieg als (weiteren) Stellvertreterkrieg verschärft und den Cyber-Krieg zwischen Russland und den USA ausgelöst. Hier könnte der neue amerikanische Präsident, der sich prorussisch gibt, eine Hoffnung bieten – wenn er denn außenpolitische Erfahrung oder zumindest diplomatisches Geschick entwickeln würde. Beides hat er bisher nicht. Seine bisherigen Vorstöße gegenüber China beweisen eher das Gegenteil. Trumps Verhalten im Wahlkampf und seitdem wirkten in der Innenpolitik polarisierend. Obama hat wenigstens versucht, friedensstiftend im Inneren zu wirken. Die Waffenlobby hat sogar indirekt geholfen, die Rassenunruhen zu verschärfen. Die Zusammensetzung der neuen amerikanischen Regierung mit sehr konservativen und häufig in der Verwaltung unerfahrenen Männern (und wenigen Frauen) erscheint eher wie das Ergebnis einer Revolution von Oben. Wie Trump und seine Regierungsmitglieder bewusst Experten und deren Wissen, z.B. durch die Leugnung des Klimawandels, in die Ecke stellte, ist allarmierend. Wie sich seine protektionistische Wirtschaftspolitik auf das Verhältnis zu Europa auswirken wird, ist eine weitere offene Frage.
BREXIT und die Folgen
Damit eng verbunden ist die nach dem BREXIT, der erheblich das innere und äußere Gleichgewicht der sonst so coolen Briten durcheinandergebracht hat. Täglich gibt es Neuigkeiten aus den tangierten Wirtschafts- und Juristenkreisen, welche finanziellen und rechtlichen Auswirkungen der BREXIT haben wird. Trotz aller offen und insgeheim geäußerten Hoffnungen auf Vermeidung der Trennung, die auf beiden Seiten des Ärmelkanals geäußert wurden: Die Trennung Großbritanniens von der EU ab März 2017 ist sicher und nicht mehr aufzuhalten – auch wenn die Regierung noch intern gespalten ist, ob und wie ein „harter“ oder „weicher“ BREXIT ausgehandelt werden soll. Die Behandlung der Frage der Ausländer, die in dem Vereinigten Königreich leben und arbeiten, ist längst nicht mehr nur eine Verhandlungssache sondern bereits zu eine Frage des inneren Zusammenhalts geworden. Viele Polen hier können ein Lied davon singen. Und – last but not least - der letzte Blog-Eintrag hatte als besondere Pikanterie auf die irische Frage hingewiesen. Diese wurde seit dem von Tony Blair ausgehandelten Kompromiss als gelöst betrachtet; sie könnte vor dem Hintergrund des BREXITS wieder aufbrechen.
Was wird aus der Europäischen Union?
Die Situation der Europäischen Union ist zudem alles andere als komfortabel: Dank guter Exportzahlen der deutschen Wirtschaft läuft auch die europäische – trotz aller Image- und Glaubwürdigkeitsverluste von Volkwagen und DEUTSCHER BANK, trotz aller andauernden Demokratiedefizite (und gleichzeitigen Bürokratie-„Überschüsse“) der Brüsseler Zentrale. Für die Bearbeitung der beiden letztgenannten Probleme hätten die Kontinentaleuropäer gern die Briten dabei behalten. Nun aber drohen im Hintergrund gefährliche populistische Strömungen, wie wir sie in Frankreich, den Niederlanden und sogar in Deutschland finden. Noch scheinen diese Kräfte, die in sich starke antieuropäische Tendenzen aufweisen, gebändigt. Was wird passieren, wenn sich die wirtschaftliche Situation innerhalb der EU verschlechtert? Welche Institutionen, Europäische Kommission, NATO, oder Gruppen können dann noch für den friedensstiftenden Zusammenhalt der europäischen Gemeinschaft sorgen?
Die europäische Ordnung droht zu zerfallen; Trump regiert, und die Satiriker freuen sich
Written by Ekkehard HenschkeSeit dem letzten Blogeintrag hat sich Einiges verändert: Bei dem Referendum am 23.06.2016 hatten sich 52 % der Briten für den Ausstieg aus der Europäischen Union gestimmt. Folgerichtig wird die neue Premierministerin Theresa May am 29. März 2017 in Brüssel der EU-Kommission dies offiziell mitteilen und die Verhandlungen dafür eröffnen.
In den Monaten dazwischen gab es auf beiden Seiten des Ärmelkanals heftige Diskussionen über die jeweiligen Vor- und Nachteile. ZEIT-Online fasste die Probleme jüngst kurz zusammen: http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/brexit-artikel-50-europaeischer-vertrag-theresa-may-antrag/komplettansicht
Nicht nur Schottland, Nordirland, die britischen Großstädte wie z. B. London stimmten gegen den Brexit. Auch Wirtschaftsverbände, die City of London und die Hochschulen warnten vor den Folgen.
Hinzu kommt der schwelende Konflikt innerhalb der britischen Union mit Schottland und Nordirland. Die Premierministerin von Schottland möchte noch vor Abschluss der Verhandlungen mit der EU ein zweites Referendum in der Erwartung, dass ihre Landsleute für den Verbleib in der EU und damit für das Verlassen des Vereinigten Königreiches plädieren werden. In Nordirland beginnt gegenwärtig eine ähnliche Diskussion, allerdings mit dem Ziel, sich mit der Republik Irland endlich vereinigen zu können.
Das stärkt nicht gerade die Verhandlungsposition der britischen Premierministerin in Brüssel.
Die EU selbst ist auch nicht von Einigkeit geprägt: Rechtspopulistische, konservative Regierungen in Ungarn und Polen machen Brüssel das Leben ebenso schwer wie die Türkei, die einmal als Beitrittskandidat betrachtet wurde, unter Präsident Erdogan aber ein autoritäres Regime etablieren will. Da die EU weitere Flüchtlingswellen aus Nah- und Mittelost verhindern will, ist sie von dem Wohlwollen der Türkei abhängig. Die starken rechten Kräfte in Frankreich, die mit der europafeindlichen Marine Le Pen sogar den nächsten Präsidenten stellen könnten, drohen die EU ernsthaft zu sprengen.
Obendrein droht Gefahr für die EU auch von den USA, wo der neue populistische Präsident Donald Trump zum Schrecken nicht nur der amerikanischen Intellektuellen dabei ist, das Gleichgewicht der Kräfte (Jurisdiktion, Legislative, Exekutive) mit einsamen Twitter-Botschaften durcheinander zu bringen und soziale Errungenschaft wie Obamas Medicare wieder rückgängig zu machen. Seine Absicht, mit dem Slogan „America first“ das empfindliche Netz der internationalen Wirtschaftsbeziehungen durch protektionistische Maßnahmen zu zerstören, würde nicht ohne politische Folgen für alle, vor allem die EU und China, sein. Es sollte nicht wundern, wenn sich dieser Präsident eben wegen seines Kampfes gegen das Establishment in relativ kurzer Zeit selbst aus dem Amt katapultieren würde.
Immerhin hat die gegenwärtig labile Lage auch ihre positiven Seiten. Nicht zuletzt für die Kabarettisten weltweit. Sie bekommen in und durch Trump, der wie ein Laienschauspieler in einer Realsatire wirkt, laufend neuen Stoff für Theatersatire.
Die Sommerpause geht zu Ende, die Geschwindigkeit auf dieser Erde nimmt wieder zu. Deshalb ein innehaltender Rückblick: Wir haben einen sogenannten mächtigsten Mann der Welt, den amerikanischen Wirrkopf als Präsidenten, der das Establishment seines Landes stürzen wollte und inzwischen von einem General mühsam zur Ordnung gerufen wurde. Wir haben eine britische Regierung, deren Premierministerin aus demokratischer Gesinnung (dem Brexit-Referendum des Vorjahres gehorchend) ihr Land von ein paar ultrakonservativen nordirischen Abgeordneten abhängig gemacht hat und nun zwischen Pragmatikern, darunter ihrem eigenen Finanzminister, und Brexit-Anhängern ihrer Partei, ihrem wirren Außenminister, hin und her pendelt. Dann gibt es den Charmeur unter den Europa-Freunden, den neuen dynamischen Präsidenten Frankreichs, der als Hoffnungsträger aller reformwilligen Europäer (und Franzosen) auftritt. Und dann haben wir noch zwei müde deutsche Wahlkämpfer, die in ihrer Einfallslosigkeit und Sattheit den deutschen Michel gut widerspiegeln. Und nur so „nebenbei“: Die Flüchtlingsströme und deren Ursachen sind immer noch nicht beendet, die Spreizungen zwischen Arm und Reich nehmen weiter zu. Ein atomarer Konfliktherd in Asien besteht nach wie vor. Eine Vorstellung, wie man den Verführungen junger Menschen zum islamistisch geprägten Terrorismus begegnen kann, gibt es auf westlich-christlicher Seite auch noch nicht. Von den sichtbaren Folgen der menschengemachten Klimaveränderungen, die der leugnende amerikanische Präsident sich jüngst selbst ansehen musste, ganz zu schweigen. Bei all diesen Problemen darf man eigentlich nur zweifelnder Optimist sein und muss man sich auf die Seite der kritischen Denker und Lenker schlagen…
Als Deutscher, der die Welt (wie im Frühjahr Süd- und Mittelamerika) bereist und von der Insel aus beobachtet, war ich zunächst sehr enttäuscht von dem Ausgang des britischen Referendums. Wo war der sprichwörtliche britische Common Sense geblieben? Hatte sich Traditionsbewusstsein mit unterschiedlichsten ökonomischen Egoismen tatsächlich mit einer Inselmentalität verbunden – gegen Weltoffenheit und Einsicht, dass nur Einigkeit in einer immer diffuser werdenden Welt stark macht? Tausend und mehr Fragen werden seit dem Entscheid einer knappen Mehrheit – gegen die Jungen und die Klugen, die die Minderheit bildeten und die Folgen zu (er)tragen haben werden – in der Öffentlichkeit diskutiert.
Darüber möchte ich nicht persönliche Verluste vergessen: Dazu zählt der Tod meines väterlichen Freundes Theodor Bergmann, der im 101. Lebensjahr sein Leben als weltoffener Sozialist, jüdischer Deutscher und Zeitzeuge in Stuttgart beendete; vgl. die Würdigungen: https://www.rosalux.de/news/id/37448/ohne-widerspruch-kein-fortschritt/
Einen Gewinn dagegen bedeutete die Lektüre der Autobiographie des immer unbequemen Dichter-Sängers Wolf Biermann, „Warte nicht auf bessre Zeiten“. Sie stellt eine wahrlich aufregende Zeitreise durch die jüngste deutsche Geschichte dar – zwischen Ost und West. Sie ist sowohl Ausdruck egozentrischer Details der Kultur in Deutschland als auch Denkmal kritischer Freundschaften, wie sie sich vor und nach Biermanns Ausbürgerung von 1976 entwickelten, die sowohl den Lebensnerv dieses Heine-Nachfolgers als auch letztlich den der bieder-verstockten DDR-Oberen traf. Zusammen mit den abgedruckten Gedichten zeigt Biermanns Lebensgeschichte den deutschen Fluss der Geschichte mit seinen oft schmutzigen Mäandern, aber dies nicht ohne Witz und Selbstironie. Seine Begegnung mit der französischen Kultur war dabei hilfreich. Nachdem ich nun die Welt erklärt habe, kommt zum Abschluss ein Lob an alle Lernbegierigen und Aufklärenden, insbesondere an die Bibliothekare und Bibliothekarinnen der Universitätsbibliothek Leipzig: Gratulation zu der Auszeichnung als „Bibliothek des Jahres 2017“! Zwölf Jahre sind es her, seitdem ich diesen sächsischen Wissensspeicher verlassen habe – am Anfang der IT-Revolution. Schauen Sie selbst, wie sich die UBL zu dieser international wirkenden Leipziger Institution weiterentwickelt hat: “Digital autonom, frei zugänglich und innovationsstark!“
More...
Old traditions and new life: Universities and colleges in Europe
Written by Ekkehard HenschkeNext to the Italian universities in Salerno (medicine since the 9th century) and Bologna (1088) it was Paris (1200) which may be called one of the oldest universities on the continent. Not much later however Salamanca (1134) in Spain.

Salamanca University building 2014
Oxford and later Cambridge (1209) in England followed. In Germany it was Heidelberg (1386) and, after leaving Prague (1348), the masters and students founded Leipzig University in 1409.

Oxford University is still very special because there is no date of foundation but there was teaching since the end of the 11th century. In 1167 King Henry II banned those English students who attended Paris University. The colleges were founded to house, feed and teach students. The oldest colleges, University College, Balliol and Merton, were founded between 1249 and 1264. Today there are 38 colleges and 6 permanent private [Christian] halls. In total ca 22.000 undergraduates and graduates students are studying at Oxford University. Oxford Brookes, the former Oxford School of Art, founded in 1865, has another 17.000 students. So there are nearly 40.000 young people in an old city of 160.000 inhabitants.
I was happy to attend two founder’s days within five years: In 2009 Leipzig University, of which I ran the library for a while, celebrated its 600th birthday. This year, 2014, Exeter College Oxford, forming the academic home of my wife, celebrated its 700thbirthday. What a wonderful day when the procession, led by the chancellor of the University, Lord Patten, and Exeter College Rector Frances Cairncross, entered the Sheldonian Theatre to celebrate Founder’s Day on Friday 4 April 2014. Trumpet fanfare and organ music introduced the ceremony which ended with everyone singing “Jerusalem”, the informal British national anthem which was written by Hubert Parry, a member of the College.

Exeter College Founder’s Day Procession 2014

Exeter College Quad [Inner Court] 2011
Irrungen und Wirrungen - von der Insel zum Festland und zurück
Written by Ekkehard HenschkeDie Reise von Oxford über Berlin und Leipzig zurück nach London und Oxford war in diesem Herbst eine politisch und kulturell besonders an- und aufregende Veranstaltung. Politisch, weil ich überall in Deutschland auf „den“ Brexit angesprochen wurde – und doch nichts Genaueres über die Entscheidungsträger berichten konnte. Schließlich erlebe ich in Großbritannien die unterschiedlichsten Reaktionen und Kommentare in den Medien (Pro Brexit: u.a. The Times, The Daily Telegraph; contra Brexit: The Guardian, I[ndependent]), die schließlich die Uneinigkeit über die Wege zum Verlassen der EU in der britischen Regierung und im Parlament in Westminster widerspiegeln. Eine klare Verhandlungsposition gegenüber den Verhandlungspartnern in Brüssel sieht anders aus. Die Reaktionen der Londoner Finanzwelt ist eindeutig für einen Verbleib in der EU, weil sie den Verlust ihrer globalen Vorrangstellung befürchtet. Ganz ähnlich, aber etwas vorsichtiger äußerte sich kürzlich die Chefökonomin des Industriellenverbandes CBI (weil sie die Stimmung nicht selbst vermiesen wollte) über die Sorgen in den anderen Wirtschaftssektoren des Vereinigten Königreichs. Das Problem Schottland ist fast völlig in den Hintergrund gerückt. Dafür ist – neben der Höhe der offenen Rechnung Großbritanniens - die Sorge um einen möglichen neuen Konflikt in den Vordergrund getreten, wenn Nordirland mit Großbritannien aus der EU ausscheiden und die angrenzende Republik Irland in der Europäischen Union verbleiben wird. In der alten Universitätsstadt Oxford, die seit Jahrhunderten aus allen Ländern qualifizierte Wissenschaftler angezogen hat, befürchtet eine große Mehrheit spätestens 2019 sowohl den Wegzug von EU-Akademikern als auch den Verlust von bisher sprudelnden EU-Forschungsmitteln. Fairerweise muss ich aber auch die kritischen Argumente von nachdenklichen Engländern wiedergeben, die auf die mangelhafte Legitimierung der EU-Bürokratie ebenso verwiesen haben wie auf ihr Unbehagen, das sie über den zunehmenden Verlust der britischen Souveränität innerhalb der EU empfinden. Hoffen wir, dass mit dem französischen Präsidenten Macron die notwendigen Reformen der EU angepackt werden. - Die Deutschen, die ich in Berlin und Leipzig sprach, schüttelten immer wieder den Kopf: Wie kann man nur aus einem so nützlichen gemeinsamen Markt aussteigen wollen? Wie kann eine sonst so vom Common Sense geprägte Nation sich so etwas antun? Ist in den britischen Köpfen nach zwei Weltkriegen die verbindende Idee der europäischen Schicksals- und Friedensgemeinschaft überhaupt angekommen? Vielleicht kommt man beim Grübeln über diese britische Gegenwartsmisere auf die Absurde in den Stücken von Samuel Beckett, dem großen Iren. Oder man versucht es mit der Interpretation der Aufforderung, die ich heute in dem OXFAM-Buchgeschäft in Oxford las: „Take my advice, I’m not using it.“
In der deutschen Universitäts- und Messestadt Leipzig macht man sich zwar auch Gedanken, wie es mit der rechtslastigen Alternative für Deutschland (AfD) weitergehen wird, nachdem sie erst in fast alle Landesparlamente und zuletzt in den Bundestag eingezogen ist. Aber im Gegensatz zu Dresden scheint man in Leipzig viel stärker immun gegenüber Rechts zu sein. In Leipzig blüht neben dem bürgerschaftlichen Engagement, seit 2002 verstärkt durch die Stiftung „Bürger für Leipzig“, eine Vielfalt sozialer und ökologischer Projekte. Und auf künstlerischem Gebiet können die Leipziger sehr gut mit den Dresdenern konkurrieren: So ist neben dem wiederbelebten Ballett unter Mario Schröder, der das Erbe des früh verstorbenen Uwe Scholz 2010 aufnahm, das Gewandhausorchester zu nennen. Es wird – leider mit Verzögerung - im Frühjahr 2018 in dem Letten Andris Nelsons einen würdigen Nachfolger von Riccardo Chailly haben. Der unermüdliche Ehrendirigent Herbert Blomstedt, der seinen 90. Geburtstag feiern konnte, meistert derweil eine große Tournee. Und das MDR-Sinfonieorchester hat bereits seit 2012 mit dem Esten Kristjan Järvi einen kompetenten Dirigenten gefunden. Auch an diesen beiden Beispielen sieht man, welchen – auch musikalischen - Gewinn die Europäische Union mit den baltischen Staaten erlebt.

Last but not least: Ein aktuelles Erlebnis war für mich und viele andere der Tag der Bibliotheken, der dieses Mal am 24. Oktober in Leipzig gefeiert wurde: Die Universitätsbibliothek Leipzig, immerhin schon 1543 gegründet, wurde als „Bibliothek des Jahres 2017“ ausgezeichnet. Als ihr ehemaliger Direktor konnte ich mich mit den Kolleginnen und Kollegen darüber sehr freuen. Was unter den Schlagwörtern „digital autonom, frei zugänglich und innovationsstark“ so gelobt wurde, ist im Internet ausführlich nachzulesen: http://www.bibliotheksverband.de/dbv/auszeichnungen/bibliothek-des-jahres/preistraeger/2017.html
Damit ist es dieser ostdeutschen Universitätsbibliothek, die mit ihrem Hauptgebäude, der Bibliotheca Albertina, lange Jahre in der DDR-Zeit ein Kümmerdasein führen musste, gelungen, sich sowohl baulich und technisch als auch organisatorisch als eine der führenden deutschen Bibliotheken zu etablieren.
Schicksale und Weisheiten in und aus Europa
Written by Ekkehard Henschke18. März 1848 – eine Revolution in Deutschland, die Viele wollten und Wenige verhinderten
In Berlin wurde am 18. März 2018 vor dem Brandenburger Tor an den demokratischen Aufbruch vor 170 Jahren erinnert. Ein Ruhmesblatt in der häufig unrühmlichen deutschen Geschichte: Am 18. März 1848 kapitulierten die Truppen des preußischen Königs vor den aufständischen Demokraten – leider nur vorübergehend.

Rainer Zunder hat dazu die ausführliche Geschichte im „Blog der Republik“ geschrieben, nicht ohne auf Volker Schröder hinzuweisen, der unser historisches Gedächtnis immer wieder auffrischt:
Leben zwischen Polen, Deutschland und Schweden
Wie eng die Schicksale vieler Menschen in Europa miteinander verbunden sind, daran erinnert der Chefredakteur der schwedischen Zeitung DAGENS NYHETER im heutigen GUARDIAN unter der Überschrift:
Weisheiten aus Norrköping
Roger Taesler (1939-2018), promovierter Metereologe und Klimaforscher (sein Bestseller von 1972: "Klimadata för Sverige"), Professor an der Königlichen Technischen Hochschule Stockholm, war vor allem ein lebensfreudiger Familienvater, Freund und Schachpartner (s. Nachrufe in "Svenska Dagbladet" und "Dagens Nyheter" vom 22.03.2018). Wir haben ihn am 09. März 2018 in seiner Heimatstadt Norrköping verabschieden müssen. Er hinterließ uns seine vier praktischen Weisheiten für Gegenwart und Zukunft:
1. "You have to be lying down before you can get up"
2. "Better listen to the string breaking than never span a bow"
BREXIT: What happens the next day if there‘s no deal?
Written by Ekkehard HenschkeSo lautete der Hauptartikel, der am 23. Februar 2019 im Londoner GUARDIAN erschien. Er hat auch uns in Oxford etwas verstört. Nach den letzten Meldungen aus der Politik vom 25. Februar, also knapp sechs Wochen vor dem offiziellen Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union, lauten die beiden Alternativen: Entweder Hinausschieben um einige Monate oder Ausscheiden ohne eine Vereinbarung. Die britische Premierministerin Theresa May, die einen Vertrag mit der EU ausgehandelt hatte, der vom Parlament abgelehnt worden war, lehnt jedoch eine Verschiebung ab.
Nach den vielen Auseinandersetzungen der letzten Monate und Wochen, die zwischen der konservativen Premierministerin und dem Parlament, zwischen Konservativen untereinander und Labour-Abgeordneten untereinander tobten, liegen bei allen Beteiligten inzwischen die Nerven bloß. Und jeder Tag bringt neue Verwirrung, so wie gestern, am 25.02., die Ankündigung der Labour-Party, ein zweites Referendum zu unterstützen.
Die Warnschüsse, die von der britischen Wirtschaft und der Wissenschaft kamen, und die Ermahnungen der EU-Spitzenpolitiker haben die Mitglieder des Unterhauses in London nur zu einem geringen Teil beeindruckt. Bleibt der bisherige Common Sense der Briten auf der Strecke? Nach Meinungsumfragen ist die Bevölkerung weiterhin gespalten.

Verschlungen die Wege zu einer Lösung wie jene in dem Gebäude der Blavatnik School of Government Oxford
Was wären die wichtigsten Änderungen für all jene, die nach einem No-Deal-Austritt ab 29. März reisen müssen oder wollen? Der GUARDIAN listete auf:
- Führerschein: Die Briten, die mit dem eigenen Auto auf dem Kontinent reisen wollten, müssten sich ab 30.März einen internationalen Führerschein für € 5,50 kaufen und die Besonderheiten bei Reisen in Frankreich und Portugal beachten. Der britische Führerschein würde nicht mehr akzeptiert.
- Europäische Gesundheitsversicherungskarte: Sie würde nicht mehr für die Briten gelten, die künftig eine entsprechende Reiseversicherung kaufen müssten.
- Mobilfunk: Mobilfunkgesellschaften schließen für die Briten nicht aus, dass sie wieder Roaminggebühren zahlen müssten, die die EU sukzessive abgeschafft hatte.
- Pensionen und Renten: Britische Rentner in der EU müssten sich Sorgen um ihre staatlichen Alterspensionen machen, insbesondere ob diese weiter jährlich angepasst würden. Private, d.h. betriebliche, Ruhegehälter wurden jedoch inzwischen geregelt.
- Reisen mit Tieren: Die EU-Passregelung für Tiere würde von teuren Untersuchungen bei jeder Reise auf den Kontinent ersetzt werden.
- Visa: Der visafreie Verkehr nach Europa würde enden und könnte von 90-Tage-Visa gegen Zahlung von 52 Pfund ersetzt werden.
Diese Punkte sind noch relativ harmlos, wenn man bedenkt, welche Probleme sich bereits jetzt in der schwächelnden britischen Wirtschaft zeigen, insbesondere bei der Autoindustrie. Die Verlagerung von Firmensitzen beweist ebenfalls große Unsicherheit. Eine Verstopfung der Häfen, die sich nach Einführung von Zollregularien durch den Rückstau von LKW mit Lebensmitteln und Gütern ergeben würde, hat das britische Transportministerium schon mal durchgespielt. Und was sich an neuer Gewalt in Irland ereignen könnte, davon haben die beiden kleinen Bombenattentate vor einigen Monaten Vorgeschmack gegeben…
Angesichts eines weiterhin gespaltenen Landes ist zu fragen, ob es überhaupt eine kurzfristige Lösung geben kann. Und die Erfahrungen der letzten Jahre mit massiven Manipulationen durch Falschinformationen werfen eine grundsätzliche Frage auf, die mittel- und langfristig zu beantworten ist: Dient die heute in der westlichen Welt praktizierte demokratische Verfassung mit Wahlen und Volksbefragungen, die von Populisten und Einflussnehmern verschiedener Couleur und geographischer Herkunft beeinflusst werden (können), noch dem gemeinen Wohl, der Res Publica? Allein zwei aktuelle Beispiele lassen Zweifel aufkommen: Das britische Beispiel einer Selbstlähmung, die das politische System zur Zeit erfährt, und das amerikanische Beispiel eines Präsidenten, der gegen alle wissenschaftlichen Zeugnisse erklärt, dass es den Klimawandel und damit die Gefahr einer zivilisatorischen Selbstzerstörung gar nicht gibt.


